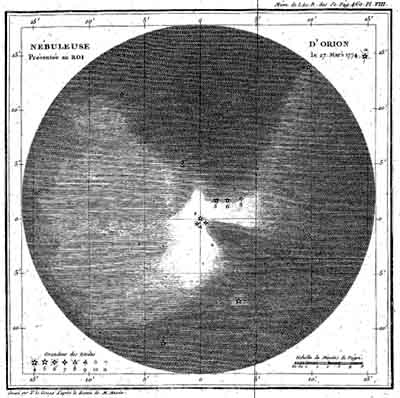zur Startseite zurück
Doppelsterne
Kontakt
Datenschutzerklärung
Inhalt :

Nicolas Claude Fabri de
Peiresc (1580-1637)

Galileo Galilei
(1564-1642)

Jean Picard
(1620-1682)

Christian Huygens
(1629-1695)

Charles Messier
(1730-1817)

Wilhelm Herschel
(1738-1822)

Johann Elert Bode
(1747-1826)

Friedrich Georg Wilhelm
Struve (1793-1864)

Edward Emerson
Barnard (1857-1923)
J.S.Schlimmer (2/2005)
Der
große
Orionnebel
ist unbestritten das schönste und am meisten beobachtete Objekt am
nördlichen Sternenhimmel : "Seine
Ausdehnung beträgt
mehr als ein Grad; der östliche Arm geht zwischen zwey sehr
kleinen
Sternen hindurch, und läuft fort, bis er einen sehr
glänzenden
Stern begegnet. Dicht an den vier kleinen Sternen, die keine Verbindung
mit dem Nebelfleck haben können, ist eine gänzliche
Finsterniß,
und innerhalb der Öffnung nach Nordost hin, ist ein
ausgezeichneter
schwacher Nebelfleck von länglicher Gestalt in einigem Abstande
vom
Rande des größeren, neben welchem er in paralleler Richtung
fortläuft, den Untiefen gleich, die man nahe an den Küsten
einiger
Inseln sieht."
So beschrieb Friedrich
Wilhelm
Herschel seine Beobachtungen über den Orionnebel 1785 in
seiner
Publikation
"Beobachtungen über den Bau des Himmels"[1]. Was F.W.
Herschel
nicht wusste, ist die Tatsache, dass es sich bei den "vier
kleinen
Sternen" lediglich um den sichtbaren Teil des riesigen
Sternhaufens
inmitten des Orionnebels handelt, die mit ihrer UV Strahlung diese
Wasserstoffregion
zum Leuchten anregen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Der Orionnebel im November 2001, R200SS, Brennweite 800 mm, 9 min belichtet auf Kodak E200 (Entwicklung um eine Blende gepushed) , J.S. Schlimmer
Über die
Entdeckung des Orionnebels findet man immer wieder die
unterschiedlichsten Namen. Da der Orionnebel unter guten Bedingungen
bereits mit dem bloßem Auge zu sehen ist, dürfte er schon
lange vor der Erfindung des Fernrohrs bekannt gewesen sein. Theta
Orionis lässt sich allerdings mit dem bloßem Auge noch
nicht trennen. Daher verwundert es auch nicht, dass Johannes Bayer in
seinem Sternatlas Uranometria (1602) Theta Orionis als einzelnen Stern
darstellte.
Als
erster
richtete 1610 der französische Astronom Nicolas Claude Fabri de
Peiresc sein Fernrohr auf den Nebel [2]. Galileo Galilei, der
ebenfalls um diese Zeit sein Fernrohr auf die Gürtelsterne und das
Schwert Gehänge richtete, rühmt sich zwar 80 neue Sterne in
dieser Region erkannt zu haben, erwähnt aber den Orionnebel mit
keinem Wort [3]. Einige Jahre später, am 4. Februar 1617
beobachtete er wiederum diese Region. Seine Beobachtungen schrieb er
ausführlich in seinem Notizbuch
nieder. Von dem Trapez sah er die
drei helleren Komponenten A, C und D. Er vermerkte, dass die
Komponenten A und
D
etwa gleich hell sind und zu der Komponente C den gleichen Abstand
haben. Ferner liegen die Komponenten A und D so dicht an C, dass
sie diese praktisch berühren [4, 13]. Damit war Theta 1 Orionis der
erste Stern, der
mit einem Teleskop in mehrere Komponenten aufgelöst wurde.
Allgemein wird die erste Entdeckung eines Doppelsterns (Mizar im
Sternbild Großem Bär) dem italienischem Astronomen Giovanni
Battista Riccioli 1650 zugeschrieben.
Giovanni
Batista Hodierna fertigte 1654 eine erste, noch sehr grobe Skizze
des Nebels an [5]. Die Skizze ist auf den ersten Blick etwas
unverständlich. Dreht man sie um 90° im Uhrzeigersinn und
spiegelt sie horizontal, dann entspricht sie der normalen Ansicht des
Himmels. Die Skizze zeigt das gesamte Schwert Gehänge des Orion. Der eigentliche
Orionnebel ist nur als Oval angedeutet. Theta 1 Orionis ist nicht
getrennt, während von Theta 2 Orionis die Komponenten A und B
dargestellt sind.
Zwei
Jahre später, im
Jahre 1656 beobachtete der niederländische Astronom Christiaan
Huygens den Orionnebel. Aufgrund seiner sehr viel genaueren Zeichnung
[6] galt Christiaan Huygens
bis ins 19. Jahrhundert als der Entdecker
des Orionnebels. Allerdings sah er - wie bereits Galileo Galilei zuvor
- von den
eigentlichen
Trapezsternen zunächst nur drei. 1673 entdeckte Abbe Jean Picard
einen vierten
Stern im Inneren. Auch Christiaan
Huygens bemerkte diesen Stern im
Jahre 1684 und nannte später diese Vierergruppe "Trapezium" [7, 8].
Charles
Messier
beobachtete
am 4. März 1769 den Orionnebel mit einem Gregory Teleskop mit 30
Zoll
Brennweite bei 104-facher Vergrößerung : „Dieser
Nebel enthält elf Sterne; davon in Richtung der Mitte hat einer
vier mit
unterschiedlichen Größen und sehr nahe einer dem anderen;
sie leuchten außergewöhnlich.“
Einige Jahre später im März 1773 fertigte er nach mehreren
Beobachtungen
„mit größter Sorgfalt“
eine genaue Zeichnung des Orionnebels und des darin
befindlichen Trapezes an. Diese Zeichnung ergänzte er mit einer ausführlichen Beschreibung
[15]. Durch die detaillierten Notizen und
Zeichnungen
haben wir heute einen Eindruck von dem, was zur damaligen Zeit ein
gutes
Fernrohr zu leisten vermochte.
Abbildung 2 : Zeichnung von Charles Messier von 1771, entnommen aus [15], großes Bild (100 kB)
Eine sehr gute Beschreibung über das Innere des Orionnebels findet man im Katalog von Johann Elert Bode von 1777. Zunächst beschreibt er, dass es sich bei dem Stern im Nebel laut Flamsteed um einen (scheinbaren) Doppelstern mit dem Namen Theta 1 Orionis und Theta 2 Orionis handelt : "(...) Theta 1 erscheint um das Vierfache in den guten Teleskopen, da es 3 kleine Sterne nah an ihm zum Osten hat; Theta 2 ist östlich des vorhergehenden und hat zwei kleine Sterne östlich nahe bei diesem. Diese zeigten an, daß sieben Sterne alle in einem klaren Nebelfleck oder leuchtendes Glühen mit einbezogen sind (...)
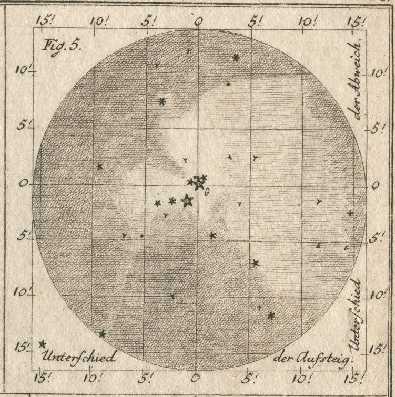
Neben den vier Trapezsternen gibt es noch vier weitere Sterne in der näheren Umgebung. Die Komponente E wurde 1826 erstmals von Friedrich Wilhelm Struve in Dorpat mit einem 9,5-Zoll-Fraunhofer Refraktor entdeckt [7, 8] (vergleiche Abbildung 4). Die ältesten astrometrischen Werte stammen hingegen erst von 1832 [11]. Die Komponente F entdeckte John Herschel 1830, die älteste Distanzbestimmung stammt aus dem Jahre 1842. Die Komponenten G und H sind hier nur zur Vervollständigung erwähnt, sie sind mit einem 8-Zoll-Teleskop aufgrund ihrer Größe von jeweils 16,7 mag nicht mehr visuell beobachtbar. Entdeckt wurden sie von Alvan Clark (G) und Edward Emerson Barnard (H) im Jahre 1888 mit dem 36-Zoll Refraktor des Lick Observatoriums.

Abbildung 4 : Von dem großen Fraunhofer Refraktor wurden insgesamt zwei Exemplare gefertigt. Der erste Refraktor wurde 1824 in Dorpat (heute Tartu, Estland) von Friedrich Wilhelm Struve in Betrieb genommen und zur Doppelsternbeobachtung eingesetzt. Nach Fraunhofers Tod 1826 wurde ein zweites, baugleiches Exemplar in seiner Werkstatt gefertigt und an die Königliche Sternwarte in Berlin geliefert. Mit diesem Teleskop entdeckte Johann Gottfried Galle 1846 den Planeten Neptun. Zur dieser Zeit gehörten diese beiden Teleskope zu den weltweit besten. Das Berliner Exemplar ist heute im Deutschen Museum in München zu besichtigen [12]. Foto : J.S. Schlimmer 1995, großes Bild (80 kByte)
Anhand dieser
Darstellung
sieht man sehr schön, dass die Entdeckung des Trapezes
direkt an die technische Entwicklung der Teleskope geknüpft war.
Um sich einen genauen Eindruck über das Leistungsvermögen von
Galileos Fernrohren zu machen, haben Jim
Mosher und Tom Pope
ein Galiläisches Fernrohr nachgebaut. Ihre Beobachtungen haben sie
mit
einer CCD Kamera mittels Okularprojektion aufgenommen und mit den
Beschreibungen und Zeichnungen Galileos direkt verglichen. Die
Ergebnisse haben Sie auf ihrer Seite CCD
Images from a
Galilean Telescope veröffentlicht [13].
Mit den heutigen Amateurteleskopen ist die Beobachtung der vier Trapezsterne von Theta 1 Orionis kein Problem. Daran zeigt sich bereits die hohe Qualität heutiger Fernrohre im Vergleich zu den besten Teleskopen der damaligen Zeit ! Bereits mit einem kleinen 3-Zoll-Spektiv wird Theta 1 Orionis bei 30-facher Vergrößerung als Trapez sichtbar. Bei 50-facher Vergrößerung stimmt der Anblick des Nebels mit der Zeichnung von Messier gut überein. Die Komponenten E und F bleiben dem Beobachter jedoch verborgen.
Beobachtet man hingegen die Trapezregion bei gleicher Vergrößerung mit meinem 8-Zoll-Teleskop, so tritt aufgrund der sehr viel größeren Lichtmenge die Schockfront (der hellste Teil im Nebel) deutlich hervor. Die Gestalt des Nebels verändert sich gegenüber der Beobachtung mit einem kleineren Teleskop (bei gleicher Vergrößerung !). Lässt sich das eigentliche Trapez mit einem 8-Zoll-Newton immer leicht auflösen, so ist die Beobachtung der Komponenten E und F sehr viel schwieriger. An manchen Tagen lässt sich E trotz guter Durchsicht gar nicht auflösen, während sie an anderen Tagen problemlos zu sehen ist. Für die erfolgreiche Beobachtung der Komponente E mit einem 8-Zoll-Teleskop reicht bei gutem Seeing bereits eine 120-fache Vergrößerung aus. In Verbindung mit einer Webcam kann die Komponente E leicht aufgezeichnet werden (Abbildung 5).

Abbildung
5 : Theta 1 Orionis (Trapez) und Theta 2 Orionis, aufgenommen im
Februar 2005 mit einer Webcam bei 1500 mm Brennweite, Mittelung
über 117 Einzelbilder, die
Helligkeit im Inneren des Nebels ist so groß, dass sich der
Nebel bereits vom Hintergrundrauschen abhebt.
Erläuterungen
:
Theta 1 Orionis
(Trapez)
:
 AB : Helligkeit :
6,55 bzw. 7,49 mag; PW : 31°; Distanz : 8,8"
AB : Helligkeit :
6,55 bzw. 7,49 mag; PW : 31°; Distanz : 8,8" AC : Helligkeit : 6,55 bzw. 5,06 mag; PW :134°; Distanz :12,8"
AD : Helligkeit : 6,55 bzw. 6,38 mag; PW : 96°; Distanz :21,2"
AE : Helligkeit : 6,55 bzw. 11,1 mag; PW :349°; Distanz : 4,9" (in Abbildung 4 : Distanz 4,3")
CF : Helligkeit : 5,10 bzw. 11,5 mag; PW :123°; Distanz : 4,0"
Theta 2 Orionis :
 AB :
Helligkeit : 5,03 bzw.
6,19 mag; PW : 93°; Distanz : 52,2"
AB :
Helligkeit : 5,03 bzw.
6,19 mag; PW : 93°; Distanz : 52,2" AC : Helligkeit : 5,02 bzw. 9,01 mag; PW : 98°; Distanz :129,4"
Die Beobachtung der Komponente F ist bereits sehr viel schwieriger, obwohl der Abstand zwischen CF immerhin noch 4,0" ist. Die Helligkeit der Komponente F ist mit 11,5 mag lediglich um 0,4 mag geringer als die von E. Doch folgende Überlegung macht den Unterschied zwischen AE und CF deutlich : Eine Helligkeitsdifferenz zweier Sterne von einer Magnitude bedeutet, dass sich ihre Intensitäten um den Faktor 2,51 (10 hoch 0,4) voneinander unterscheiden. Hiernach ergibt sich für AE ein Intensitätsverhältnis von 1 : 60, für CF hingegen von 1:360. Die Komponente F wird durch die viel hellere Komponente C leichter überstrahlt und ist daher schwerer zu beobachten.
Bei sehr gutem Seeing, welches sich häufig über schneebedeckten Flächen einstellt, konnte ich am 27.02.2005 erstmalig auch die Komponente F mit meinem R200SS beobachten. Bereits bei 94-facher Vergrößerung zeigten sich in meinem 16mm Nagler Typ 5 Okular alle 6 Komponenten auf den ersten Blick. Noch deutlicher konnte ich alle Komponenten bei 120-facher Vergrößerung mit dem 12,5 mm orthoskopischen Okular sehen. Mit der Philips ToU Webcam lassen sich mit meinem 8-Zoll-Newton-Teleskop Sterne bis ungefähr 11,2 mag aufnehmen. Die Komponente F liegt mit 11,5 mag bereits außerhalb der Reichweite der Webcam.
Fertigt man eine Zeichnung des Orionnebels an, so lassen sich die Zeichnungen von Huygens und Messier besser beurteilen. Die Sterne im Innern des Nebels lassen sich leicht skizzieren, den Nebel richtig darzustellen, ist dagegen sehr schwer. Meine Zeichnung (Abbildung 6) entstand am 28.02.2005 bei 94-facher Vergrößerung. Die Lufttemperatur betrug ca. -9° bis -10° C.
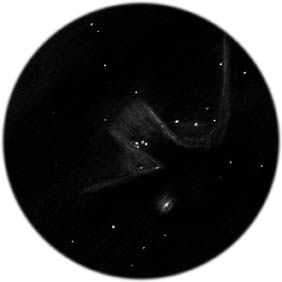
Abbildung 6 :
Zeichnung des Orionnebels bei 94-facher Vergrößerung,
Februar 2005, R200SS mit Telekonverter, 16mm-Nagler Typ 5 Okular
Veränderliche im Trapez
Im Trapez findet man
gleich zwei Veränderliche : Theta 1 Orionis A ist auch unter der
Bezeichnung
V1016 Orionis bekannt. Seine Helligkeit schwankt zwischen 6,75 und 7,8
mag, seine Periode beträgt 65,43 Tage. Der zweite
Veränderliche
im Trapez ist Theta 1 Orionis B, der auch die Bezeichnung BM Orionis
trägt.
Es handelt sich um einen Bedeckungsveränderlichen mit einer
Periode
von 6,47 Tagen. Die Amplitude beträgt 0,6 mag. Mehr Informationen
über diese beiden Veränderlichen finden Sie unter [14]
Weitere Informationen
Das Grab von
Galileo Galilei in der Basilika Santa Croce in Florenz
Charles Messier
original Beobachtungsbericht
über M42
Quellennachweis :
[1] Friedrich Wilhelm Herschel, Über den Bau des Himmels, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Verlag Harri Deutsch Band 288
[2] Harenberg Schlüsseldaten Astronomie, Harenberg Verlag
[3] Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Nachricht von neuen Sternen, Insel-Verlag 1965
[4] Galileo Galilei, Analecta Astronomica
[5] Giovanni Batista Hodierna, De Systemate Orbis Cometici, Deque Admirandis Coeli Characteribus, http://xoomer.virgilio.it/_XOOM/fdemaria2/pagg__18-19.html
[6] Christiaan Huygens, Systema Saturnium 1659, Smithsonian Institution Libraries, http://www.sil.si.edu/DigitalCollections/HST/Huygens/huygens-ill8.htm
[8] M42 Diffuse Nebula NGC 1976, http://www.eso.org/outreach/eduoff/edu-prog/catchastar/CAS2003/casreports-2003/rep-067/
[9] Catalog of Nebulae and Star Clusters, http://www.seds.org/messier/xtra/history/m-cat.html
[10] Ueber einige neu entdeckte Nebelsterne und einem vollständigen Verzeichnisse der bisher bekannten, von Herrn Bode, http://bozo.lpl.arizona.edu/messier/xtra/similar/bode_o.html
[11] Brian D. Mason, Gary L. Wycoff, and William I. Hartkopf, The Washington Double Star Catalog, http://ad.usno.navy.mil/wds/
[12] Gerhard Hartl, Der Refraktor von Joseph von Fraunhofer, Die Entdeckung des Planeten Neptun,Deutsches Museum München,
http://www.deutsches-museum.de/ausstell/meister/fraun.htm
[13] Tom Pope, Jim Mosher, CCD Images from a Galilean Telescope, http://www.pacifier.com/~tpope/index.htm
[14] Bela Hassforther, Veränderliche im Orion-Nebel, http://www.bela1996.de/astronomy/orion-vars.html
[15] Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématique et de physique tirés des registres de cette Académie 1666-1699 (I-XI). 1699-1790, (im Nachtrag von 1774 zu 1771, Seite 461), Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, http://gallica.bnf.fr/
[16] Vorstellung der Gestirne 1782 auf XXXIV Tafeln, aus der Neuauflage von 2003 http://www.lsw.uni-heidelberg.de/bode/
Seitenaufrufe
seit dem Februar 2005 :